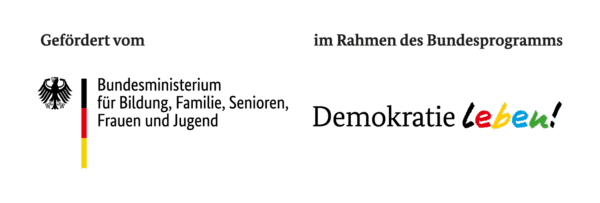Ambiguitätstoleranz
Ambiguitätstoleranz
Das Konzept der Ambiguitätstoleranz ist nicht nur Bestandteil der neuen Förderrichtlinie des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ im Programmbereich der Partnerschaften für Demokratie, sondern diskutiert eine wesentliche Fähigkeit der zwischenmenschlichen Interaktion.
Es beschreibt die Fähigkeit andere Meinungen zu akzeptieren und widersprüchliche Aussagen auszuhalten. Die Ambiguitätstoleranz ist ein wesentliches Instrument der demokratischen Teilhabe und der Diskursfähigkeit zwischen den Menschen. (vgl. Zusammen im Dialog 2023)
Theoretischer Rahmen des Konzepts
Else Frenkel-Brunswick erkannte zwei Dynamiken, die eine Persönlichkeit innehaben kann, die Ambiguitätstoleranz und das Gegenstück die Ambiguitätsintoleranz. Während die Toleranz der Ambiguitäten Fähigkeiten umschreibt, sich auf einen Dialog einzulassen, dahinterstehende Probleme, Widersprüchlichkeiten und Herausforderungen anzuerkennen und gemeinsam im Diskurs Meinungen zu reflektieren, beschreibt die Ambiguitätsintoleranz die Unfähigkeit widersprüchliche Gefühle in einem Diskurs zuzulassen und gemeinsam Möglichkeiten und Lösungen zu erkennen, die vielleicht im Dissens zu eigenen Auffassungen stehen, jedoch für eine adäquate Auseinandersetzung mit Meinungen und Auffassungen zielführend sind. (vgl. Zusammen im Dialog 2023)
Eine gute Ambiguitätstoleranz wirkt sich auf das subjektive Wohlbefinden aus und dient dem Aufbau von Resilienz (vgl. Becker 2023), also der psychischen Widerstandsfähigkeit gegenüber psychischem und innerpsychischem Stress, Krisen und Krisensituationen (vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2018).
Sie entsteht vermutlich in der Kindheit durch Lernen und Lernerfahrungen im Kontext mit einer gelingenden Beziehungsgestaltung. Wissenschaftlich erklärbar könnte dies mithilfe der Auseinandersetzung mit „Gut“ und „Nicht gut“ gemacht werden. Lernen Menschen frühzeitig sich und das eigene Umfeld zu akzeptieren und tolerieren, gleichzeitig aber auch kritisch zu hinterfragen, so werden sie gut mit Widersprüchlichkeiten umgehen können. Sie lernen also nicht zwangsläufig, die eigene Meinung als „gut“ und die andere als „nicht gut“ zu titulieren. Trifft nun auf diesen Prozess des Lernens ein guter Beziehungsstil, der von Feinfühligkeit und Zugewandtheit geprägt ist, so können junge Menschen lernen, für sich selbst gut zu sorgen und darüber hinaus daraus spendend eine reflektierende Fürsorge für sich und die Auffassungen der anderen aufzubauen. Frenkel-Brunswick erkannte in ihrer Zusammenarbeit mit Kindern, dass einige die Auffassungen ihrer Eltern gut hinterfragen konnten, ohne dass dabei große Konflikte aufkamen. Sie lernten vermutlich für sich eine Strategie widersprüchlichen Argumentationen kritisch aber dennoch wohlwollend gegenüberzustehen und dabei aufkochende Emotionen gezielt zu kontrollieren. Damit scheint der Aufbau einer guten Ambiguitätstoleranz eine der Entwicklungsaufgaben zu sein, denen sich junge Menschen stellen müssen. (vgl. Nixdorf 2025)
Literatur
Becker, Julia (2023): Ambiguitätstoleranz (Ambivalenzfähigkeit) fördern. https://lehreladen.rub.de/die-lehrenden-im-fokus/resilienz-im-lehralltag/ambiguitaetstoleranz-foerdern/ (Abfrage: 20.09.2025)
Fröhlich-Gildhoff, Klaus/Rönnau-Böse, Maike (2018): Was ist Resilienz und wie kann sie gefördert werden?. https://izi.br.de/deutsch/publikation/televizion/31_2018_1/Froehlich-Gildhoff_Roennau-Boese-Resilienz.pdf (Abfrage: 20.09.2025)
Nixdorf, Christian-Philipp (2025): Ambiguitätstoleranz. https://www.socialnet.de/lexikon/Ambiguitaetstoleranz (Abfrage: 20.09.2025)
Zusammen im Dialog (2023): Ambiguitätstoleranz. https://zusammen-im-dialog.de/wissensplattform/ambiguitaetstoleranz/ (Abfrage: 20.09.2025)