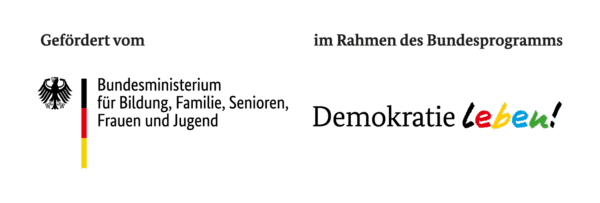Ableismus
am Beispiel von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen
Eins vorweg: Projekte, die sich mit der Zielgruppe Menschen mit Beeinträchtigungen/besonderen Hilfebedarf im Kontext von demokratischer Beteiligung und Teilhabe an partizipativen Prozessen auseinandersetzen, sind gern gesehen.
Der Begriff Ableismus beschreibt die wahrnehmbare Ausgrenzung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Er diskutiert diskriminierende Zuschreibungen oder Vorurteile, zeitgleich aber auch Barrieren, welche die Lebensqualität und Lebenswelt der Betroffenen massiv beeinträchtigen oder sich derart manifestieren können, dass psychische oder seelische (Begleit-)Erscheinungen aufrechterhalten oder gar verschlimmert werden. (vgl. Maskos 2023) Das SGB IX beschreibt Behinderungen in folgender Art und Weise: „Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gemeinschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können.“ (§ 2 Abs. I SGB IX)
In der psychischen Gesundheit sind ableistische Haltungen keine Seltenheit und werden für Betroffene deutlich spürbar. Pathologisierende Bewusstseinstrübungen und internal- sowie externalattribuierende Zuschreibungen beeinflussen nicht nur das Erleben und Verhalten der Betroffenen sondern bieten ebenso eine „Angriffsfläche“ für urteilende Stigmatisierungen jeder Art. (in Anlehnung an Davison u. a. 2007)
Zunächst ist allerdings wichtig, die Definition einer Behinderung genau zu analysieren und diskutieren. Sie beinhaltet wesentliche Parameter, die Davison, Neale und Hautzinger im Rahmen einer Merkmalsbeschreibung bei psychischen Beeinträchtigungen erkannten. Damit gemeint ist die Beeinträchtigung der Lebensführung. Sofern Menschen von teilhabeorientierten Angeboten ausgeschlossen werden, sind sie zumeist in ihrer Lebensführung beeinträchtigt. Ferner meint aber dieses Merkmal auch einen intrinsisch vorgegebenen Rückzug, der durch die pathologisierenden Eigenschaften einer psychischen Erkrankung auftreten kann. Weiterhin definieren Davison, Neale und Hautzinger noch die a.) statistische Seltenheit, b.) das Verletzen der sozialen Normen, c.) das persönliche Leid und d.) das unangemessene Verhalten als zentrale Grundeigenschaften einer psychischen Erkrankung. Während a.) gemessen auf die Weltgesamtbevölkerung ist, definieren nebenst genannte Faktoren internal und external erkennbare Eigenschaften der Pathologisierung. (vgl. Davison u. a. 2007, S. 6 ff.)
Was braucht es, um ableistische Haltungen gegenüber Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen zu reduzieren? Zunächst muss es sowohl bei Außenstehenden als auch bei dem betroffenen Menschen selbst eine Haltung der Sensibilisierung und Akzeptanz geben. Daher sind sozialraumbezogene Angebote, die dies fokussieren, bedeutsam und bieten Raum akzeptierende, teilhabefokussierende Gespräche zu realisieren. In der Psychiatrie/Psychotherapie wird von psychoedukativen Übungen gesprochen, die für Betroffene ein Bewusstsein für ihr Leiden schaffen (vgl. LVR Klinikum Düsseldorf 2025). Gleichzeitig können parallel fördernd sozialraumbezogene Workshops für Außenstehende realisiert und ein akzeptanzbasierendes Bewusstsein für die Menschen erreicht werden. Der persönliche Eindruck, der sich gelegentlich auftut, ist jener, dass Veränderungen lediglich bei den Betroffenen selbst, weniger bei der Gesellschaft, erreicht werden sollen.
Literatur
Davison, G. C./Neale, J. M./Hautzinger, M. (2007): Klinische Psychologie. 8. Auflage. Beltz
LVR Klinikum Düsseldorf (2025): Psychoedukation. URL: https://klinikum-duesseldorf.lvr.de/de/nav_main/fachgebiete/therap_dienst/psychotherapeutische_therapieverfahren/psychoedukation/Inhaltsseite_KV.html (Abfrage: 01.11.2025)
Maskos, R. (2023): Ableismus und Behindertenfeindlichkeit. Diskriminierung und Abwertung behinderter Menschen. In: Bundeszentrale für Politische Bildung. URL: https://www.bpb.de/themen/inklusion-teilhabe/behinderungen/539319/ableismus-und-behindertenfeindlichkeit/ (Abfrage: 01.11.2025)
SGB IX als Rechtsgrundlage (Fassung: 2018)